Augustinus
Augustinus von Hippo (Aurelius Augustinus Hipponensis, 354–430 n. Chr.) war ein römisch-afrikanischer Theologe und Philosoph. Er gilt als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Entwicklung des westlichen Christentums und der westlichen Philosophie. Seine Schriften, zu denen seine Autobiografie „Confessiones“ (Bekenntnisse) und das theologische Werk „De civitate Dei“ (Der Gottesstaat) gehören, haben einen tiefgreifenden und andauernden Einfluss ausgeübt.
Hier sind einige Schlüsselaspekte seines Lebens und Denkens:
- Frühes Leben und Bekehrung: Augustinus wurde in Thagaste (dem heutigen Souk Ahras, Algerien) in der römischen Provinz Numidien geboren. Seine Mutter, Monika, war eine gläubige Christin, während sein Vater, Patricius, ein Heide war, der erst auf dem Sterbebett zum Christentum konvertierte. Als junger Mann verfolgte Augustinus eine klassische Ausbildung und eine Karriere als Rhetoriker. Er führte ein Leben, das er später als sündhaft beschrieb, und war zeitweise ein Anhänger des Manichäismus. Ein entscheidender Moment in seinem Leben war seine Bekehrung zum Christentum, die er in seinen „Bekenntnissen“ eindrücklich schildert. Im Jahr 387 wurde er in Mailand von Bischof Ambrosius getauft.
- Bischof von Hippo: Nach seiner Bekehrung kehrte Augustinus nach Nordafrika zurück und wurde 391 zum Priester geweiht. Im Jahr 396 wurde er Bischof von Hippo Regius, eine Position, die er bis zu seinem Tod innehatte. Als Bischof war er ein produktiver Schriftsteller und Prediger, der sich an theologischen Debatten beteiligte und die christliche Lehre mitgestaltete.
- Wichtige Werke: Augustinus‘ literarisches Schaffen war umfangreich. Zu seinen bekanntesten Werken zählen:
- „Confessiones“ (Bünkenntnisse): Eine spirituelle Autobiografie, die seinen Weg von einem Leben in Sünde und intellektuellem Irrglauben zu seiner Bekehrung zum Christentum schildert. Es ist ein tiefgründiges Werk der Selbsterforschung und eines der einflussreichsten Bücher, die je geschrieben wurden.
- „De civitate Dei“ (Der Gottesstaat): Ein monumentales Werk, das als Antwort auf die Plünderung Roms im Jahr 410 n. Chr. verfasst wurde. Augustinus verteidigt das Christentum gegen die heidnische Anschuldigung, es sei für den Niedergang des Römischen Reiches verantwortlich. Das Buch entwirft die Vision von zwei Gesellschaften: der „Stadt des Menschen“, die sich auf irdische Ziele konzentriert, und der „Stadt Gottes“, die aus jenen besteht, die Gott lieben und nach seinem Willen leben.
- „De Trinitate“ (Über die Dreifaltigkeit): Eine detaillierte theologische Abhandlung über das Wesen Gottes als Dreifaltigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist).
- Theologische Beiträge: Augustinus‘ Denken ist ein Eckpfeiler der christlichen Theologie. Er ist bekannt für seine Arbeiten über die Erbsünde, die göttliche Gnade, das Wesen der Sakramente und die Dreifaltigkeitslehre. Er beteiligte sich auch an bedeutenden Debatten gegen Häresien seiner Zeit, wie den Donatismus und den Pelagianismus.
- Vermächtnis: Augustinus gilt als einer der vier großen lateinischen Kirchenväter, zusammen mit Ambrosius, Hieronymus und Gregor dem Großen. Seine Ideen beeinflussten das mittelalterliche und moderne christliche Denken sowie die westliche Philosophie maßgeblich. Er wird in der katholischen Kirche als Heiliger und Kirchenlehrer anerkannt, und sein Einfluss erstreckt sich auf verschiedene protestantische Konfessionen. Sein Gedenktag wird am 28. August, dem Tag seines Todes, gefeiert.
Die Lehre von der Gnade und der Erbsünde
Ein zentrales Thema, das Augustinus‘ Theologie maßgeblich beeinflusst hat, ist der Streit mit dem Mönch Pelagius. Pelagius vertrat die Ansicht, der Mensch sei von Natur aus gut und in der Lage, aus eigener freier Willenskraft das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Sünde sei eine bewusste Entscheidung und nicht etwas, das dem Menschen anhaftet.
Augustinus widersprach dieser Ansicht entschieden. Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen und seiner Interpretation der Bibel entwickelte er eine Lehre, die bis heute kontrovers diskutiert wird:
- Erbsünde: Augustinus argumentierte, dass die Sünde Adams und Evas die gesamte Menschheit infiziert hat. Jeder Mensch kommt demnach mit einer sündhaften Natur auf die Welt. Diese Erbsünde bedeutet nicht, dass jeder Mensch von Geburt an die Schuld Adams trägt, sondern dass die menschliche Natur seit dem Sündenfall von einem Defekt, einer Neigung zum Bösen (der Konkupiszenz), geprägt ist. Der menschliche Wille ist dadurch geschwächt und unfähig, aus eigener Kraft das Heil zu erlangen.
- Gnade: Aus der Lehre der Erbsünde folgt für Augustinus die Notwendigkeit der Gnade Gottes. Da der Mensch von Natur aus nicht zum Guten fähig ist, kann er nur durch Gottes Gnade erlöst werden. Diese Gnade ist ein freies und unverdientes Geschenk Gottes. Er betonte, dass sogar der Glaube selbst ein Gnadengeschenk ist. Diese Überzeugung führte zur Entwicklung seiner Gnadenlehre, die ihm den Titel „doctor gratiae“ (Lehrer der Gnade) einbrachte.
Der freie Wille und die Prädestination
Augustinus‘ Gnadenlehre wirft unweigerlich die Frage nach dem freien Willen auf. Er lehrte, dass der Mensch vor dem Sündenfall einen freien Willen hatte, das Gute zu wählen. Nach dem Fall hat der Mensch zwar immer noch einen Willen, aber dieser ist so geschwächt und der Sünde unterworfen, dass er aus sich selbst heraus unfähig ist, das Heil zu wählen. Die göttliche Gnade ist daher unwiderstehlich für diejenigen, die Gott erwählt hat.
In der späteren Auseinandersetzung mit den Pelagianern entwickelte Augustinus seine Lehre der Prädestination (Vorherbestimmung) weiter. Er argumentierte, dass Gott schon im Voraus bestimmt hat, welche Menschen zum Heil gelangen werden und welche nicht. Die Gründe für diese Wahl bleiben dabei ein göttliches Geheimnis.
Einfluss auf Philosophie und Theologie
Augustinus‘ Denken hatte weitreichende Konsequenzen:
- Verbindung von Antike und Christentum: Er schuf eine Synthese zwischen der platonischen Philosophie und der christlichen Theologie. Seine Betonung der inneren Erfahrung und der Suche nach der Wahrheit in der Seele („In Dir, in der Wahrheit, liegt die Freude.“) floss stark in seine Gedanken ein.
- Grundlage für das Mittelalter: Seine Schriften wurden zur Grundlage der westlichen Theologie für das gesamte Mittelalter. Insbesondere die Vorstellung vom „Gottesstaat“ prägte das Verhältnis von Kirche und Staat.
- Reformation: Auch die Reformatoren Martin Luther und Johannes Calvin bezogen sich stark auf Augustinus‘ Lehre von der Erbsünde und der Gnade. Luthers Aussage, der Mensch sei „knechtische Willens“, ist direkt von Augustinus‘ Pessimismus über die menschliche Natur inspiriert.
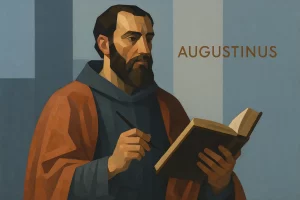
Augustinus über die Zeit
In Buch XI seiner „Confessiones“ stellt Augustinus eine der berühmtesten philosophischen Fragen: „Was ist also die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es; wenn ich es aber einem Fragenden erklären will, weiß ich es nicht.“
Er erkennt, dass die Zeit kein fester, materieller Gegenstand ist. Er argumentiert, dass die Vergangenheit nicht mehr existiert und die Zukunft noch nicht. Nur die Gegenwart ist real, aber sie ist so flüchtig, dass sie keinen Raum einnimmt. Er löst dieses Rätsel, indem er die Zeit nicht als etwas Äußeres betrachtet, sondern als eine innere Erfahrung der Seele.
- Vergangenheit: Die Erinnerung (memoria) an Vergangenes.
- Gegenwart: Die direkte Wahrnehmung (contuitus) des Gegenwärtigen.
- Zukunft: Die Erwartung (expectatio) von Zukünftigem.
Für Augustinus ist die Zeit also eine „Ausdehnung der Seele“ (distentio animi). Der Mensch misst die Zeit, indem er die Dauer von Erinnerungen, Erwartungen und der flüchtigen Gegenwart in seinem Geist wahrnimmt. Dieses Konzept hat Denker wie Edmund Husserl, Martin Heidegger und Henri Bergson tief beeinflusst.

